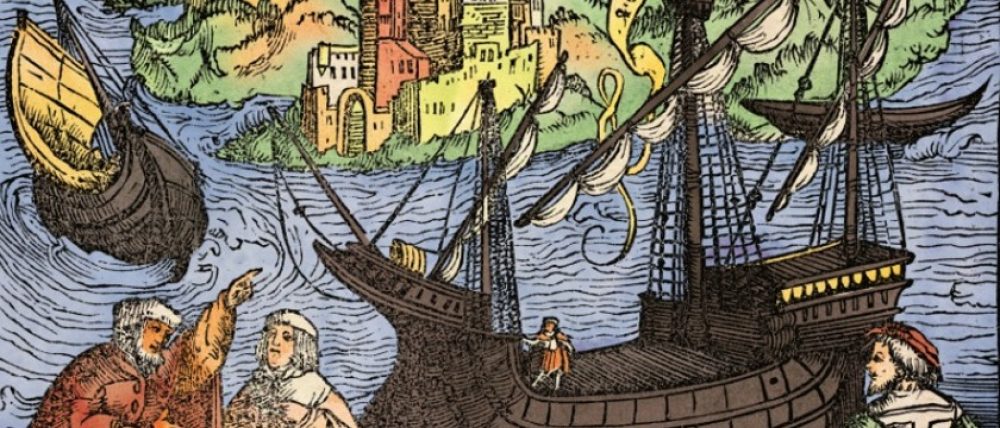Die 10.Donnerstagsdemo am 6.12. wurde von „System Change not Climate Change“ zum Thema Klimagerechtigkeit organisiert. An der überraschend dynamischen Demo nahmen zwischen 3500 und 6000 Menschen nehmen teil. Am Dach des Verkehrsministeriums gab es eine Pyro- und Transpieinlage („FPÖVP aus dem Verkehr ziehen“). Vor dem Schwedenplatz wurde sich kurz die Straße von unten vom Autoverkehr zurückerobert. Die Demo zog weiter durch die Innenstadt und endete vor dem Haus der EU in der Wipplingerstraße.
Am Tag darauf wurde die NeLe, ein besetztes Haus in Ottakring geräumt. Es war ca. 2 Wochen geheim und 3 Tage öffentlich besetzt. Die Polizei war darauf bedacht, dass nach außen ein Bild der Besonnenheit und Verhältnismäßigkeit entsteht. Dort, wo es keine Öffentlichkeit gab, setzte es aber auch Schläge und Tritte. 1 Person sitzt seitdem in U-Haft, eine Kostenübernahme des Polizeieinsatzes an die Besetzter*innen steht im Raum.
Am 10.Dezember demonstrierten 60 Menschen gegen Massenabschiebungen nach Nigeria und Afghanistan, die in den beiden tagen darauf stattfanden.
Die 11.Donnerstagsdemo fand das erste Mal nicht in der Innenstadt statt. Zwischen 2700 und 5000 Menschen drehten eine Runde durch Ottakring. Dabei gab es wieder Pyroshows und Transpis in der Nachbarschaft. Es war die letzte Demo vor der Winterpause.
Am Samstag darauf gab es Großdemo. Anlass war der Jahrestag der Angelobung der blau/schwarzen Regierung. Hier zeigte sich die ganze Widersprüchlichkeit der Bewegung. Im Vorfeld wurde die traditionelle Route über die die MaHü verboten. Die Demo musste auf die wesentlich unattraktivere Burggasse ausweichen. Demoverbote werden Tradition: Erst wenige Tage vorher, am 5.Dezember, wurde eine antifaschistische Demo an der Uni verboten.
Die Demo selbst war mit ca. 30.000 Menschen (Polizei: 17.000, orga: 50.000; nochrichten Zählung bei der Burggasse: zwischen 20.000 und 25.000 Menschen) trotz dichten Schneefalls sehr gut besucht. Versuche, das Demoverbot zu kippen, gab es jedoch nicht. So wurde Widerstand geübt, indem mensch widerstandslos Verbote hinnahm; so wurde Stärke gezeigt, in dem mensch sich im vorauseilenden Gehorsam der Polizei ausliefert.
Einen Tag später wurde ersichtlich, wohin das Ganze führen kann: Wegen ein paar Schneebällen wurden mehr als 1300 Menschen eines Rapid-Fanmarsches 7 Stunden lang in der Kälte auf engsten Raum ohne Trinken, Essen; WC eingekesselt. Möglicherweise war es eine Racheaktion für eine Anti-Polizei-Choreographie wenige Tage zuvor. Auf jeden Fall war es eine Machtdemonstration der Polizei, die jedoch zu einer großen Solidaritätswelle innerhalb der Fußballszene führte. Wichtig ist auch eine Solidarität darüber hinaus – auch zum Selbstschutz. Denn es ist klar, über kurz oder lang werden wir auch davon betroffen sein.
An einer Demo gegen den EU-Afrika-Gipfel, gegen Abschiebungen und neokoloniale Träume, am 17.Dezember nahmen an die 110 Personen teil.
Die Polizei löste in der Silvesternacht einen schon fast traditionellen Rave auf. Dabei gab es auch heftige Gegenwehr. Zumindest ein Polizeiauto wurde demoliert, 7 Menschen wurden angezeigt.
Fazit: Die letzten Demos des Jahres waren ein Wegweiser für die kommenden Proteste. Mit Demoverboten, Kessel, U-Haft, Massenabschiebungen gab es heftige polizeiliche Repression. Es gab aber auch einiges an Solidarität; es nehmen weiterhin sehr viele Menschen an den Protesten teil. Auf der anderen Seite gibt es nach wie vor viel Planlosigkeit, viel vorauseilender Gehorsam und viel Angst. Dass es wir selbst sind, hier etwas verändern können, das glauben nach wie vor die wenigsten.
Wenn wir wieder Mut in uns selbst finden, dann kann 2019 ein durchwegs spannendes Jahr werden.